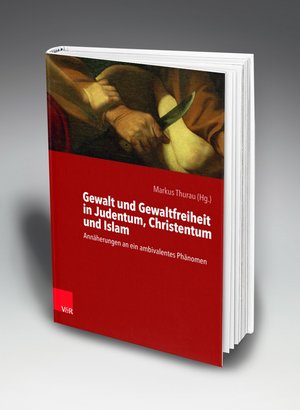Gewalt und Gewaltfreiheit in Judentum, Christentum und Islam.
Der vorliegende Band ist eine Dokumentation einer Tagung, die das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw) 2016 veranstaltete, denn das Thema „Religion und Gewalt“ ist in den letzten zwei Jahrzehnten zu einem äußerst komplexen Forschungsfeld geworden“. Das kann nur unterstrichen werden, weshalb der Band äußerst begrüßenswert ist, bietet er doch einen ausgezeichneten Einblick in die gegenwärtige Forschungs- und Diskussionslandschaft. Dass er sich auf die drei monotheistischen Religionen beschränkt, ist nicht nur kein Nachteil, sondern bietet die Möglichkeit einer konzisen Zusammenschau in diesem Bereich, ohne in allzu große Breite gehen zu müssen.
Durchgängig zieht sich die Frage nach Gewalt und Gewaltfreiheit, ganz wie es im Titel angekündigt wurde. Die Gliederung des Bandes in vier Teile ist übersichtlich:
Der erste Teil behandelt die Grundschriften der jeweiligen Religion, im zweiten werden exemplarisch Konflikte dargestellt, der dritte Teil widmet sich der Friedens- und Konfliktforschung in den jeweiligen religiösen Gemeinschaften und der abschließende vierte Teil fragt nach der Bedeutung des Themas in der Bundeswehr.
Bei den Aufsätzen vor allem im ersten und dritten Teil wird deutlich, dass alle genannten Religionen sowohl das Potential zur Gewalt als auch zur Gewaltfreiheit und Friedensstiftung haben. Es kommt darauf an, was die Menschen daraus machen. Die Autoren sind sich der Schwierigkeit sehr bewusst (und deklarieren sie auch), zwischen den oft idealtypischen Grundtexten und der oftmals vorhandenen und religiös legitimierten Gewaltbereitschaft unterscheiden zu müssen.
Damit wird aber auch klar, dass Religion immer politisch ist, und zwar sowohl, wenn sie als Gewaltlegitimierung, als auch, wenn sie als Gewaltbefreiung interpretiert wird. Damit geht der Band - ohne es zu deklarieren - von einer westlich geprägten Sicht von Religion aus, dass zwar Religion die Beziehung zwischen Mensch und Gott beschreibt, diese aber einer menschlichen Interpretation bedarf und zum Teil selber menschliche Interpretation ist. Eine solche Sicht lässt eine „göttlich gegebene Wahrheit“ nur sehr bedingt zu.
Die Frage nach einer religiös legitimierten Gewalt und einer religiös legitimierten Gewaltfreiheit wird damit zu einem Teil der Kultur des gesellschaftlichen Zusammenlebens. In diesem Zusammenhang ist der Aufsatz von Heinz-Günther Stobbe bemerkenswert, der dankenswerterweise das in der öffentlichen Wahrnehmung kaum bekannte Thema der Gewalt gegen (!) die Religion behandelt. Es stellt sich allerdings die Frage, ob sich diese westliche Zugangsweise auch bei jenen Menschen findet, denen die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr (und anderer westlicher Streitkräfte) in Afghanistan begegnen.
Dass ein solcher bemerkenswerter Band gerade in der Werkstatt des Militärs entstanden ist, kann nicht verwundern. Gerade beim Militär wird einer interkulturellen Kompetenz großes Augenmerk zugemessen; nicht nur wegen der laufenden Auslandseinsätze, sondern auch wegen der zunehmenden Notwendigkeit im Inland. Um in dieser praxisorientierten Hinsicht vertiefte Impulse bieten zu können, hätte es einer intensiveren Behandlung des Themas (im vierten Teil) bedurft. So entfaltet der Band sein Schwergewicht in der intellektuellen Behandlung der Frage.
Die Beiträge reichen von wissenschaftlichen Erörterungen der heiligen Schriften (wie bspw. den Beitrag von Thomas R. Elßner über das Buch Josua) bis hin zu praxisorientierten Beiträgen. Bemerkenswert ist es überdies, dass es sich bei den Beiträgen um kritische Selbstreflexionen handelt; d.h. der Herausgeber die Autoren so ausgewählt hat, dass sie über ihre jeweils eigene Religion schreiben. In der Zusammenschau treten die Autoren mit ihren Beiträgen jedoch in eine Art Dialog ein, der dem Buch einen frischen diskursiven Charakter gibt.
Wie es einem solchen Band zukommt, werden die heute so schnell geäußerten Stereotypen (vom „friedlichen Christentum“ und einem „gewaltbereiten Islam“) aufgebrochen. Die Frage nach dem Umgang mit Gewalt wird heute in erster Linie dem Islam gestellt. Dessen ist sich auch Autor des sehr instruktiven Beitrags dazu, Muhammad Sameer Murtaza, bewusst und leitet seine Gedanken damit ein, bevor er ein vieler westlicher Leser wohl unbekanntes, aber darum umso instruktiveres Bild des Islams und seiner Traditionen der Gewaltfreiheit präsentiert. Aber auch für das Christentum und das Judentum finden sich im Band bemerkenswerte Zusammenschauen und neue Überlegungen, die das Buch zu einer wertvollen Lektüre werden lassen.
-krt-