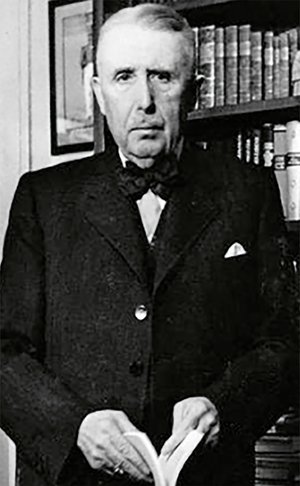Schweiz im Kalten Krieg
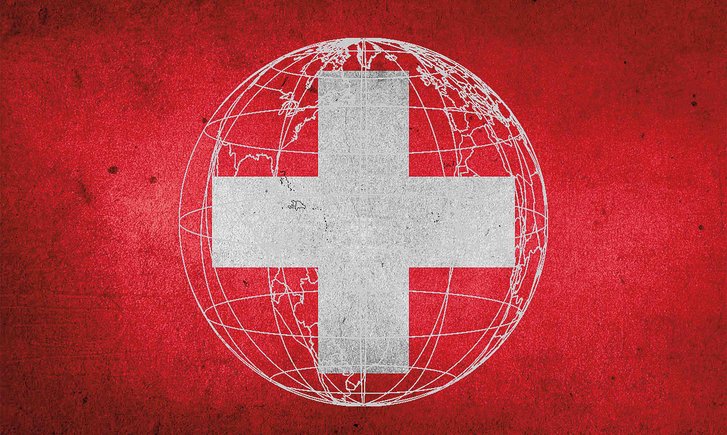
Die Schweiz fürchtete immer einen Angriff des Warschauer Paktes. So organisierten die Eidgenossen für den Schutz ihrer Wirtschaft „Sitzverlegungen“ von Schweizer Unternehmen ins Ausland. Die Suche nach dem idealen Standort führte sie rund um den Globus. Für geheime Verhandlungen besuchten die Schweizer paradiesische Inseln und beinahe alle Kontinente. Zugleich rüstete die Schweiz ihre Verteidigungskräfte erfolgreich zur militärischen Abschreckung auf.
Der Schweizerische Bundesrat regelte im April 1957 für den Fall einer Besetzung des Staates die „Sitzverlegung“ von schweizerischen Unternehmen nach Übersee. Die folgende Darstellung lässt sich nur verstehen, wenn man „die unmittelbare Bedrohung der Schweiz im Zeitalter des Kalten Krieges wahrnimmt“, so Sacha Zala, Direktor der Forschungsstelle „Diplomatische Dokumente der Schweiz“. Zala weiter: „Damals lebte die Schweiz in einem Zustand der ständigen Vorbereitung auf eine mögliche Aggression.“
„In der Schweiz war der Kalte Krieg kälter als anderswo“, so der Historiker Thomas Buomberger in seinem 2017 erschienenen Buch „Die Schweiz im Kalten Krieg 1945 bis 1990“. Die Eidgenossenschaft war ideologisch und wirtschaftlich klar ein Teil der westlichen Welt und entwickelte sich zu einer anti-kommunistischen Hochburg. Würde in Europa ein Krieg ausbrechen, so die allgemeine Vermutung, wäre die Schweiz vom Kriegsgeschehen mit Sicherheit indirekt, wenn nicht sogar direkt, betroffen.
Der damalige Feind, der mit Atombomben drohte und die Schweiz kommunistisch zu unterwandern suchte, saß in Moskau. Daher galt: Wer des Kommunismus verdächtigt wurde, musste mit Ausgrenzung und dem Verlust seines Arbeitsplatzes rechnen. Zudem entwickelte sich ein Überwachungsstaat, der etwa 900 000 Menschen „fichierte“, d. h. überwachte. 700 000 davon standen damals ohne gesetzliche Grundlage unter Beobachtung. Das Ausmaß der Überwachung wurde erst 1989 im so genannten „Fichenskandal“ sichtbar. Der Begriff „Schnüffelstaat Schweiz“ machte die Runde.
Idee „Sitzverlegung“
Wegen der Bedrohung durch die Staaten des Warschauer Paktes gab es während des Kalten Krieges in der Schweiz Überlegungen, wieder jene Verteidigungsmaßnahmen zu treffen, die bereits nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges galten. Auch Frankreich und die Benelux-Staaten verfolgten ähnliche Planungen. Befeuert haben diese vor allem die sowjetische Niederschlagung des Ungarn-Aufstandes (offiziell vom 23. Oktober 1956 bis 4. November 1956; Kämpfe teils bis Anfang 1957) und die Suezkrise (29. Oktober 1956 bis März 1957). Aus Sicht der Schweizer Bundesbehörden handelte es sich dabei um einen wichtigen Baustein im komplexen System der Landesverteidigung.
Deshalb begann das Eidgenössische Politische Departement bereits 1951, Möglichkeiten für eine „Sitzverlegung“ von Schweizer Unternehmen auszuloten. Es war konkret vorgesehen, dass nach einem Einmarsch fremder Truppen in die Schweiz die Sitze eingemeldeter Unternehmen in ein neues Regierungszentrum im noch unbesetzten Gebiet im Inland oder falls nötig, sogar ins Ausland wechseln würden. Dadurch sollten insbesondere die Auslandsaktivitäten betroffener Unternehmen dem Zugriff einer Besatzungsmacht entzogen und zugleich davor geschützt werden, von einer Gegenseite als „Feindgut“ behandelt zu werden.
Erste „Sitzverlegungen“
Als potenzieller Gegner war nur der Warschauer Pakt denkbar. Etwa 2 400 Firmen ließen sich vorsorglich für eine Sitzverlegung registrieren, andere setzten Sofortmaßnahmen. So leitete Hoffmann-La Roche den Konzern von einer Niederlassung in den USA aus, während beispielsweise die Swissair ihre Zentrale schon während des Krieges 1940 nach Locarno-Magadino im Tessin verlagerte. Von dort aus startete der Flugbetrieb vorerst in die damals nicht kriegsführenden Staaten Italien und Spanien. Die Destination Locarno-Barcelona wurde während des Zweiten Weltkrieges vor allem von jüdischen Emigranten als Tor in die Freiheit genutzt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg
Zu Beginn der 1950er-Jahre war für den Fall eines sowjetischen Angriffes auf die Schweiz vorgesehen, mit der Swissair-Flotte Piloten zu evakuieren, um eine „freie schweizerische Luftwaffe“ im Ausland zu bilden. Die Passagiermaschinen hätten die Schweiz nur noch im äußersten Notfall besucht. Nestlé überstand den Krieg ohne vollständige Sitzverlegung. Die Filiale in den USA erwies sich dennoch als äußerst vorteilhaft: Durch die Abgabe von Nescafé an die alliierten Streitkräfte verbreitete sich dieser Kaffee mit den Truppen weltweit.
Die Sitzverlegungsbeschlüsse von 1939 und 1941 wurden am 15. Mai 1945 vom Bundesrat aufgehoben. Nach dem Auslaufen dieser Regelungen ging es darum, Ersatz zu schaffen. So beauftragte 1949 Justizminister Eduard von Steiger, der auch zwei Mal Schweizer Bundespräsident war, den Rechtsprofessor an der Universität Genf, Georges Sauser-Hall, mit der Ausarbeitung einer Neuregelung. Diese wurde 1957 erlassen und ging weiter als jene von 1939. Über die beiden Bundesratsbeschlüsse vom 12. April 1957 „betreffend vorsorgliche Schutzmaßnahmen für juristische Personen, Personengesellschaften und Einzelfirmen“ sowie „über den Schutz von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden durch vorsorgliche Maßnahmen“ berichtete die „Neue Zürcher Zeitung“ („NZZ“) unter dem Titel „Wirtschaftliche Kriegsvorsorge – Eine Presseorientierung.“ In der „NZZ“ vom 25. November 1958 erschien der Artikel „Der Schutz der schweizerischen Auslandsinvestitionen“.
Bei allem Engagement der Experten konnte jedoch eine große Unwägbarkeit nicht aus dem Weg geschafft werden, wie Eduard von Steiger schon 1954 festgestellt hatte: „Ich muss immer wieder darauf hinweisen, dass wir nicht alles regeln können. Insbesondere können wir keine Regelungen vorsehen für den Fall, wo sich keine schweizerische Exilregierung konstituieren könnte.“
Idee erneut aufgegriffen
Wichtige Einblicke gibt eine Aktennotiz an Robert Kohli, den Chef der Abteilung für Politische Angelegenheiten und Generalsekretär des Eidgenössischen Politischen Departementes, vom 1. Mai 1959. Dort heißt es auszugsweise: „Auf eine kurze Formel gebracht, liegt Sinn und Zweck der Sitzverlegung darin, einerseits schweizerische Firmen und die in ihnen verkörperten Interessen im Kriegsfall unserer Volkswirtschaft zu erhalten und dem eventuellen Zugriff einer Besetzungsmacht nach Möglichkeit zu entziehen, anderseits aber auch, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass schweizerische Vermögenswerte im Falle einer Okkupation unseres Territoriums durch eine Kriegspartei von der Gegenpartei nicht als Feindesgut behandelt werden.“
Dieses Ziel sollte dadurch erreicht werden, dass die ihren Sitz ins Ausland verlegenden Gesellschaften grundsätzlich überall den im Zeitpunkt der Sitzverlegung geltenden Bestimmungen des schweizerischen Rechtes unterworfen bleiben sollen. Vor allem ging es um ihre Errichtung und ihr Personalstatut. Lediglich in Bezug auf die wirtschaftliche Tätigkeit der Schweizer Firmen am neuen Sitz sollten die dort jeweils geltenden Bestimmungen des öffentlichen Rechtes anwendbar bleiben.
Vorausschauende Maßnahme
Die Anmeldung der Sitzverlegung durch eine Firma bedeutete nicht die sofortige Verlegung des Sitzes. Es handelte sich vielmehr um eine für die Zukunft gedachte Vorsichtsmaßnahme. Der Zeitpunkt, wann sie Rechtswirksamkeit erlangt, würde in einem späteren Beschluss durch den Bundesrat bei Eintritt der vorgesehenen Gefährdung bestimmt. Wäre der Bundesrat infolge eines Krieges dazu nicht mehr in der Lage, so würde die Sitzverlegung, die nur temporär und transitorisch sein soll, rechtswirksam.
Sitz-Suche
Schon vor Erlass des Sitzverlegungsbeschlusses wurde vom „Politischen Departement“ geprüft, welche Länder als Asylstaaten infrage kommen könnten. Eine Umfrage erstreckte sich auf Lateinamerika mit seiner unsicheren politischen Lage, die USA mit ihrem komplizierten Rechtssystem und der Ungewissheit der künftigen Haltung des Kongresses, der sich nach US-Konzeption an zeitlich vorausgegangene zwischenstaatliche Abmachungen nicht gebunden fühlte – oder die südamerikanische Insel Curaçao mit der damaligen Gefahr einer Loslösung vom Mutterland Niederlande, Südafrika mit seinem Rassenproblem, Australien mit seiner „allzu exzentrischen geografischen Lage“ und Kanada. Man gelangte zum Schluss, dass in Kanada die besten wirtschaftlichen, politischen, geografischen und juristischen Voraussetzungen für die Aufnahme sitzverlegter schweizerischer Firmen vorliegen würden.
Idealstaat Kanada
Da der Sitzverlegungsbeschluss auf die schweizerische Rechtsordnung zugeschnitten wurde, war es erforderlich zu prüfen, inwiefern der gewünschte Erfolg innerhalb der Rechtsordnung eines Asylstaates auch wirklich erreicht werden könnte. Die Schweiz trat zu diesem Zweck mit Ende 1957 an die kanadischen Behörden heran. Eine Schweizer Aktennotiz dazu: „Wir (…) haben dort zwar viel Sympathie für unser Anliegen, aber bekanntlich auch gewisse Hemmungen angetroffen (Präjudiz, Steuerfragen etc.). Es wäre uns daran gelegen, von Kanada, eventuell im Rahmen eines Notenwechsels, gewisse generelle Zusicherungen zu erhalten, dass den Zwecken unseres Sitzverlegungsgesetzes im Ernstfall von kanadischer Seite Rechnung getragen würde. Wir hoffen, spätestens im Herbst mit den zuständigen kanadischen Stellen Expertenbesprechungen in Ottawa aufnehmen zu können.“ Die Anliegen waren
- die Anerkennung der Sitzverlegung ohne vorherige Liquidation und Reorganisation,
- die Anerkennung des schweizerischen Personalstatutes,
- die Regelung gewisser Steueraspekte zur Vermeidung von Doppelbesteuerung und
- Zusicherungen in Bezug auf eine künftige Feindesgut-Gesetzgebung.
Die Aktennotiz weiter: „Parallel dazu ist es gelungen, in Panama, durch Einflussnahme unseres Honorarkonsuls, der gleichzeitig Nestlé-Vertreter ist, den Erlass eines so genannten Auffanggesetzes zu provozieren, das bewusst auf den schweizerischen Sitzverlegungsbeschluss zugeschnitten wurde. Ähnliche Bemühungen in Curaçao haben noch nicht zum Erfolg geführt.“
Anfangs geringes Interesse
Das Interesse für die Sitzverlegung schien in den schweizerischen Wirtschaftskreisen zu Beginn noch gering zu sein. Anfangs lagen erst rund ein Dutzend Anmeldungen vor, wobei als Asylstaaten Kanada (Nestlé u. a. m.), Südafrika, Panama, USA, Curaçao und Mosambik gewählt wurden. „Im Falle einer Zuspitzung der internationalen Lage müsste aber wohl mit einer rapiden Zunahme der Anmeldungen gerechnet werden.“ lautet die Aktennotiz.
Anmeldung zur Sitzverlegung
Die Neuregelung sah vor, dass im Fall internationaler Konflikte ein Unternehmen seinen Sitz vorübergehend an den Ort der „verfassungsmäßigen schweizerischen Regierung“ oder an einen frei gewählten Ort im In- oder Ausland verlegen kann. Der Beschluss dazu wurde wie im Zweiten Weltkrieg vereinfacht, indem er ohne Generalversammlung zu fassen war. Die Firma musste ihre Absicht dem Handelsregisteramt melden, das ein alphabetisches Verzeichnis führte und die zuständige diplomatische Vertretung im Ausland informieren musste.
Wie auch aus der angeführten Aktennotiz hervorgeht, war es aber in der Praxis gar nicht so einfach, einen geeigneten „Asylstaat“ zu finden. Zwar war die Standortsuche primär Sache der Unternehmen, doch war ihnen der Bund dabei behilflich. Anfang Oktober 1959 machte sich dann eine Delegation mit Funktionären der Bundesverwaltung und der Wirtschaft auf den Weg nach Kanada, um die bestehenden Möglichkeiten auszuloten.
Verhandlungen mit Kanada
Die Angelegenheit war äußerst delikat und komplex, weil sie unterschiedliche Rechtssysteme betraf und daher eine Reihe von Problemen politischer, rechtlicher und steuerlicher Art aufwarf, wobei sich Letztere als besonders schwierig erwiesen. Am 14. Oktober 1959 hieß es in einem Memorandum über die Gespräche: „In vielen Punkten konnte eine Einigung erzielt werden. Schweizer Unternehmen hätten ihren Sitz unter Beibehaltung ihrer Schweizer Rechtspersönlichkeit nach Kanada verlegen können und das nordamerikanische Land bot den Vertretern des Managements Visaerleichterungen an.
In Steuerfragen blieben die Meinungsverschiedenheiten aber bestehen.“ Kanada bekräftigte nämlich entgegen den Schweizer Hoffnungen, dass Unternehmen für ihre gesamten Aktivitäten der kanadischen Besteuerung unterliegen würden. Für dieses Teilabkommen galt für beide Länder strengste Verschwiegenheit. 1968 kam es zu einem ähnlichen Abkommen mit Australien und auf Betreiben der Firmen Nestlé mit Panama sowie der Swissair mit Mexiko.
Neutralitätsprobleme
Die Bundesbeschlüsse zur Sitzverlegung von Schweizer Firmen brachten allerdings gewisse Probleme mit der Schweizer Neutralität mit sich, weil Ostblockstaaten bei der Suche nach Asylländern nicht in Betracht kamen und die erwogenen Maßnahmen der Schweiz für die Sitzverlegung – wenn auch nicht explizit – auf der Annahme beruhten, dass ein Angriff durch Staaten des Sowjetblockes erfolgen würde. Der Historiker Bernhard Stüssi stellt daher in seiner Untersuchung „Transfer to Canada? Das Projekt zur Sitzverlegung schweizerischer Firmen im Krisenfall 1949 bis 1959“ die Frage in den Raum, ob vorsorgliche Maßnahmen zum Schutze der Schweiz, wie sie die Sitzverlegungspläne darstellten, dem damaligen Neutralitätsrecht widersprochen haben, indem sie eine potenzielle Kriegspartei favorisierten.
Während dies nach schweizerischer Auslegung der Neutralität nicht der Fall war, wäre die Antwort der Sowjetunion vermutlich kritischer ausgefallen. Rudolf Bindschedler, Verfasser der „Bindschedler-Doktrin“, lieferte die inoffizielle neutralitätsrechtliche Richtschnur für den Bundesrat: „Eine wirtschaftliche Neutralität besteht nur insofern, als der dauernd neutrale Staat keine Zoll- oder Wirtschaftsunion mit einem anderen Staat abschließen darf, da er sich sonst mehr oder weniger seiner Unabhängigkeit auch in politischer Hinsicht berauben würde. Im Übrigen besteht keine wirtschaftliche Neutralität.“ Gemäß dieser Definition waren die Sitzverlegungspläne nicht neutralitätswidrig, sofern diesbezüglich kein Staatsvertrag geschlossen wurde.
Ende des „Papierkrieges“
Vereinzelt wurden – etwa 1978 – Zweifel an dem Konzept geäußert. Der SP-Nationalrat Martin Bundi kritisierte in einer Interpellation solche „Geheimabkommen“, weil sie „einem veralteten sicherheitspolitischen Bild“ entsprächen. Allerdings löste er damit keine große Debatte mehr aus. Überraschend ist, dass die Dekrete den Fall der Berliner Mauer überlebten. Der Historiker Bernhard Stüssi spricht in seiner Studie von einem „Papierkrieg“, der 2017 formell endete. Diese Dekrete verloren ihre Grundlage bei einer Totalrevision des Landesversorgungsgesetzes. Dort wurden die inzwischen 60 Jahre alten Bundesratsbeschlüsse explizit aufgehoben.
Militärische Neuausrichtung
Die veränderte politische und strategische Situation der Nachkriegszeit zwang die Schweiz zu einer militärischen Neuausrichtung. Die Erfahrungen hätten gezeigt, dass in einem künftigen Krieg der Schutz der Bevölkerung und des stark industrialisierten Mittellandes im Vordergrund stehen müsste. Der Schweizer Militärexperte Peter Veleff hielt 2007 fest: „Die Neutralität der Schweiz war während des Kalten Krieges nie eine ideologische.“ Denn 1945 verfügte die Schweizer Armee weder über eine Panzerwaffe noch war sie auf eine nukleare Bedrohung eingestellt.
Stärkung der Armee
Mit der „Truppenordnung 61“ wurde die Armee den Erfordernissen des Kalten Krieges angepasst. Neben der Aufstellung von drei mechanisierten Divisionen bewilligte das Parlament zudem die Beschaffung von 150 Kampfpanzern, 540 Schützenpanzern und 100 Überschallflugzeugen des Typs „Mirage IIIS“. In seiner Botschaft zur „Truppenordnung 61“ formulierte der Bundesrat: „Die Angriffe können mit oder ohne Atomwaffen erfolgen; für die Vorbereitung der Abwehr muss mit dem schlimmeren Fall gerechnet werden.“ Ziel war es also nicht, sich auf das wahrscheinlichste Szenario, sondern auf den schlimmsten Fall vorzubereiten. Denn im Ernstfall hätte die Schweiz keinerlei Kontrolle über dessen Ausmaß gehabt.
Die „Area Defence“, die von Berner Offizierskreisen und vom Vorsteher des Eidgenössischen Militärischen Departements, Karl Kobelt (FDP), favorisierte Raumverteidigungs-Doktrin, entsprach der damals neuen Bedrohungsanalyse. Diese ging von einer sowjetischen Aggression und einer Umklammerung durch Truppen des Warschauer Paktes aus. Deshalb rechnete die Schweiz damals mit einem künftigen Konflikt zwischen den Supermächten, ausgetragen auf dem europäischen Kontinent mit Angriffen der Sowjetunion aus dem Nordosten.
Raumverteidigung
Die territoriale Verteidigung bestand nach dieser Konzeption aus einem tief gestaffelten System von Verteidigungsstützpunkten, an denen der Gegner mit gezielten Gegenangriffen zurückgehalten und zermürbt werden sollte. Beeinflusst war die Idee davon, dass die Schweizer Armee nicht über ausreichend mechanisierte Kampfmittel für ein Bewegungsgefecht verfügte.
Zivilschutz
Das Bundesgesetz über die baulichen Maßnahmen im Zivilschutz, das 1964 in Kraft trat, schrieb bei sämtlichen Neubauten in der Schweiz den Bau von Schutzräumen vor. Im internationalen Vergleich war der bauliche Zivilschutz der Schweiz während des Kalten Krieges in seinen Ausmaßen einmalig.
Sinnkrise
Der Kalte Krieg verschwand im Jahr 1991 mit der Sowjetunion. Die Schweizer Armee geriet dadurch in eine Art Sinnkrise und musste sich zusammen mit der gesamten Sicherheitspolitik neu ausrichten. Den Höhepunkt dieser Entwicklung bildete die „Armeeabschaffungsinitiative“, bei der am 26. November 1989 35,6 Prozent für die Abschaffung der Armee stimmten.
Fazit
Während der Zeit des Kalten Krieges bereitete sich die Schweiz mit der „Strategie der Dissuasion“ (Abschreckung) auf den Ernstfall vor. Dies wurde in den Staaten des Warschauer Paktes sehr wohl wahrgenommen. Das bestätigt folgende Aussage von Generalmajor Hans Deim, dem früheren „Chef Operativ“ der Nationalen Volksarmee der DDR: „Nennen Sie mir einen einzigen vernünftigen Grund, weshalb wir ohne Not in schweizerisches Territorium eindringen sollten, um uns dort mit vier gut gerüsteten und gut ausgebildeten schweizerischen Armeekorps in einem für uns schwierigen Gelände anzulegen, während wir schon im Kampf mit starken NATO-Verbänden gestanden hätten, deren Zerschlagung unser Ziel war.“
Hptm aD Professor Ing. Ernest Enzelsberger, MBA; Präsident der Gesellschaft für Landesverteidigung und Sicherheitspolitik in Vorarlberg

Dieser Artikel erschien im TRUPPENDIENST 1/2025 (402).