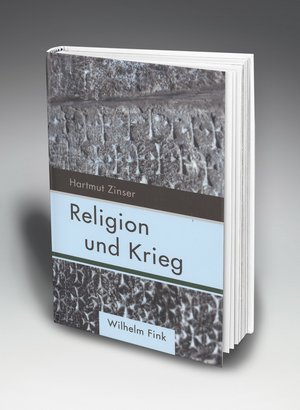Religion und Krieg
Der Verfasser stellt zu Beginn seine Grundthese vor:
„Selbst Religionen, die explizit jede Gewaltanwendung und alles Töten und Rauben verwerfen, haben in bestimmten gesellschaftlichen und geschichtlichen Situationen Kriege religiös legitimiert oder gar als Gottes Wille verkündet.“ (Seite 10)
Das, was auf den ersten Seiten als Angriff auf die Religion verstanden werden kann, entwickelt sich sehr schnell zu einer sehr ernst zu nehmenden Kritik an den friedenstheologischen Positionen der einzelnen Religionen.
Hartmut Zinser ist emeritierter Professor für Religionswissenschaft der Freien Universität Berlin. In Wien hielt er im Sommersemester 2013 eine Vorlesung über „Religion und Krieg“. Mit seiner jüngsten Untersuchung trifft er eine der Kernfragen der gegenwärtigen Diskussion, die angesichts der (pseudo-) religiös motivierten Attentate hochaktuell ist. Die Untersuchung richtet sich wegen ihres Schreibstils und der reflektierenden Argumentation aber weniger an ein breites Publikum als vielmehr an Leserinnen und Leser mir einer religionsgeschichtlichen- oder -historischen Vorbildung.
Der Verfasser ist auf der einen Seite sehr vorsichtig mit Religionskritik:
„Ob es wirklich Kriege gegeben hat, die allein aus religiösen Gründen, mit religiösen Motivation und religiösen Zielen geführt wurden, kann man mit guten Gründen bezweifeln.“ (Seite 10)
Zinser bezieht in seine Überlegungen auch den modernen Terrorismus mit ein (Kap. VI). In den allermeisten Religionen findet Zinser klare Friedensgebote. Aber dennoch konstatiert der Verfasser gleichzeitig auch allen Religionen ein gewaltsames Potential. Er kann beides, die pazifistischen wie die bellizistischen Tendenzen, mit zahlreichen Zitaten belegen. Der Verfasser vertritt die Ansicht, „dass alle Religionen aus sich selber nicht friedfertig sind“ (186). Deshalb: „Die Religionen blieben und bleiben doppeldeutig.“ (185)
Nach einer eingehenden Behandlung der Begriffe „Krieg“ und „Religion“ (Kap. II) bildet einen Schwerpunkt der Studie die Beschäftigung mit dem christlichen Konzept des bellum iustum, des rechtfertigbaren Krieges. Zinser spannt aber einen weiten historischen Bogen, der die verschiedenen Akzentuierungen der Beziehung von Religionen zu Krieg und Gewaltanwendung zeigt. Athene in Griechenland und Mars in Rom waren Kriegsgötter, der Krieg gehörte zur Normalität. Die Heldenverehrung bei den Germanen förderte einen positiven Zugang zum Krieg. Im Christentum war der Krieg durch die Bellum-Iustum-Lehre (Kap. IV) zwar Teil der Wirklichkeit, wurde aber zur Abnormalität, die tunlichst zu verhindern war. Trotzdem wurden aber auch Kreuzzüge geführt. Auch mit dem Hinduismus (97ff.) den im Westen zumeist mit Pazifismus verbundenen buddhistischen Lehren setzt sich Der Verfasser kritisch auseinander (106ff.). Der Islam (114ff.) weist zwar Beschränkungen für die Kriegsführung auf, hat aber dennoch eine umfangreiche Lehre über das Töten im Krieg entwickelt. Es gilt aber für alle Religionen, dass „der Ausdruck heiliger Krieg … besonders umstritten (ist)“ (26). „Was es aber auf jeden Fall gegeben hat, sind religiös begründete und interpretierte Kriege.“ (28)
Anhand von geschichtlichen Ereignissen macht die Studie deutlich, wie sehr sich z.B. auch das Christentum von seiner ursprünglich pazifistischen Grundlage entfernt hat. Impulse kamen dazu weniger von der Religion resp. ihren Vertretern als vielmehr aus dem profanen Bereich. Im Westfälischen Frieden von 1648 wurde festgelegt, dass Religion kein Grund mehr für Kriege sein darf. Den Religionen musste, so eine andere These des Verfassers, die Friedfertigkeit erst durch den staatlichen oder gesellschaftlichen Bereich aufgedrängt werden. „Heute reden zwar alle oder doch die meisten Religionen auf den verschiedenen Konferenzen für den Frieden, wenn aber der konkrete Fall eintritt, schweigen sie oder suchen eine mühsame Rechtfertigung.“ (60) Das gilt auch, wenn es sich um kriegsbefürwortende Personen der eigenen Religionsgemeinschaft handelt.
In seinem Schlussplädoyer vertritt der Verfasser deshalb die Ansicht, dass allen Religionen „der Friede im Zweifelsfall auch aufgezwungen werden muss“ (186). Die Vertreter der Religionen müssten klare Worte gegen den Krieg finden. Außerdem fordert er, dass die Religionen ihre universalen und absoluten Wahrheitsansprüche aufgeben müssen, denn Religionen sind, jedenfalls waren in ihrem Kern nicht kompromissfähig“ (69). Ebenso erhofft er von einer Entpolitisierung der Religionen (vgl. 71 u.ö.) die Basis für ein gemeinsames Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Religionen und Konfessionen. Sie müssten sich „nicht nur mit ‚repressiver Toleranz‘ ertragen“, sondern sollte sich als „gleichberechtigt und gleichwertig anerkennen“ (Seite 186).
-krt-