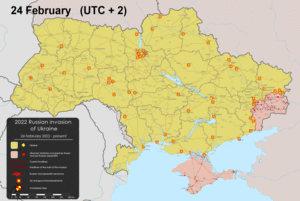- Veröffentlichungsdatum : 06.04.2022
- – Letztes Update : 13.04.2022
- 5 Min -
- 947 Wörter
- - 3 Bilder
Ukraine-Krieg: Strategische und operative Aspekte

Der 24. Februar 2022 markiert den Beginn des Ukraine-Krieges und einen Tabubruch. Die politischen Hintergründe des Krieges wurden in der Berichterstattung der vergangenen Wochen breit thematisiert. Die wesentlichen strategischen und operativen Aspekte aus Sicht der Militärwissenschaft, wurden jedoch weniger beleuchtet.
Zur Einordnung der strategischen und operativen Aspekte des Ukraine-Krieges müssen zuerst die Prinzipien des strategischen Handelns betrachtet werden. Die klassischen Machtinstrumente eines Akteures sind Diplomatie, Wirtschaft, Militär und Information. Kombiniert man diese erfolgreich, können strategische Ziele erreicht werden. Um die (möglichen) strategischen Ziele Russlands nachvollzuziehen, eignet sich ein Blick auf die Entwicklungen seit dem Jahr 1989, als die Berliner Mauer fiel. Dieses Ereignis markiert den Beginn jener Entwicklungen, die 1991 zum Ende des Kalten Krieges, des Warschauer Paktes und der Sowjetunion als Weltmacht in einer bipolaren Konstellation führten. Seit damals wurde einerseits die sowjetische, in weiterer Folge russische, Einflusssphäre schrittweise verkleinert. Gleichzeitig „expandierte der Westen“ bzw. dessen Institutionen, wenn man die NATO und die EU als solche interpretiert, ab diesem Ereignis in den Osten. Blickt man in das Jahr 2022, erkennt man eine deutlich fortgeschrittene NATO-Osterweiterung, die auch Gebiete der ehemaligen Sowjetunion umfasst (siehe Grafik).
Die US-Militärzeitschrift „Operational Environment Watch“ analysierte bereits im Dezember 2021 Aussagen des russischen Präsidenten Wladimir Putin vom Herbst 2021 zur NATO-Osterweiterung. Die Quintessenz daraus ist die Angst vor bzw. die Ablehnung des weiteren Vordringens der NATO nach Osten. Damit verbunden ist der Wille, die Ukraine davon abzuhalten, NATO-Mitglied zu werden. Noch am Tag vor dem Angriff auf die Ukraine betonte Putin, dass die Ukraine ein integraler Bestandteil der russischen Geschichte und Kultur sei. Ein NATO-Beitritt des Staates stelle daher eine direkte Bedrohung für Russland dar. Außerdem sei die russische Bevölkerung in der Ukraine bedroht und müsse geschützt werden. Diesem Narrativ folgend sei ein russisches Handeln unumstößlich und ein mögliches Blutvergießen die alleinige Schuld der Ukraine. Mit der Anerkennung der (prorussischen) ostukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk als Volksrepubliken unterstrich Putin seine Absichten, der bald Taten folgen sollten.
Die von Wladimir Putin formulierten strategischen Kerninteressen Russlands lassen sich wie folgt zusammenfassen: Der Puffer zur NATO soll erhalten und der Zugang zum Schwarzen Meer gesichert bleiben. Um diese Ziele zu erreichen, gab es zu Kriegsbeginn aus militärischer Sicht drei Umsetzungsmöglichkeiten für einen Angriff auf die Ukraine:
- Eine Minimum-Variante mit der Inbesitznahme der Separatistengebiete Donezk und Luhansk inklusive der Krim, mit der der Schwarzmeer-Zugang gesichert wäre.
- Eine Variante mittlerer Ambition mit einer Besetzung der Ostukraine und einem Stoß von Norden entlang des Dnepr als Trennlinie mit der Vereinnahmung der Separatistengebiete und der Krim.
- Ein massiver Angriff inklusive Regimewechsel und Teilung der Ukraine als robusteste Variante, mit einem zentralen Stoß auf die Hauptstadt Kiew und einen gleichzeitigen Angriff aus dem Süden zur Zerschlagung der ukrainischen Streitkräfte.
Drei Wochen nach dem Beginn des Krieges zeigt sich, dass Russland den Entschluss für die robuste Variante der Kriegsführung gefasst hat. Die Operationen der Landstreitkräfte finden in mehreren Stoßrichtungen vom Norden und Nordosten Richtung Kiew sowie, ebenfalls in mehreren Stoßrichtungen vom Nordosten, Osten und Süden Richtung Dnepr statt. Komplettiert werden diese durch Luftschläge und Raketenangriffe in der Tiefe.
Ein nächster Schritt könnte die Zusammenführung der Stöße im Norden sowie aus dem Süden sein, zur Abtrennung ukrainischen Truppen im Osten. Der Dnepr bietet sich auch hier als natürliche Trennlinie mit wenigen Übergangsmöglichkeiten an. Andererseits könnte Russland Kiew und andere große Städte isolieren, einschließen und in einem verlustreichen Häuserkampf weiter bekämpfen. Dazu ist anzumerken, dass die aktuellen Entwicklungen (Stand: 6. April 2022) einen Rückzug der russischen Kräfte aus Kiew zur Folge hatten, Mariupol und anderer Städte noch immer belagert werden.
Der Krieg in der Ukraine lässt einige Folgerungen zu: So hat sich gezeigt, dass Russland (zumindest seine aktuelle Führung) bereit ist zu handeln, wenn es seine vitalen Interessen gefährdet sieht. Die Eskalation geschah innerhalb kürzester Zeit, wenngleich sich der Wandel der Beziehung zwischen Russland und dem Westen sowie die zunehmenden Spannungen abgezeichnet haben. Der Angriff kam dennoch unerwartet und somit überraschend. Genauso überraschend kam die damit verbundene – und für viele erschreckende – Erkenntnis, dass ein konventioneller Krieg in Europa nach wie vor möglich ist. Dieses Szenario galt jahrzehntelang bei vielen als völlig unrealistisch.
Trotz dieser unerwarteten Lageentwicklung im Osten Europas zeigt sich derzeit eine „strategische Vernunft“ des Westens. Europas oberste Priorität heißt Deeskalation, auch wenn das eine vermeintliche militärische Defensive bedeutet. In den Bereichen Diplomatie, Wirtschaft und Information kann das strategische Handeln Europas als überlegen bezeichnet werden. Bewertet man die ersten sechs Wochen des Ukraine-Krieges anhand der Anfangs beschriebenen Machtinstrumente zeigt sich, dass die russische Führung die strategische Lage wohl falsch einschätzte.
Auf der Ebene der Diplomatie ist Europa so geeint wie noch nie, während Russland diplomatisch zunehmend isoliert ist. Der Bereich der Information gestaltet sich zu Ungunsten Russlands, das den „Propagandakrieg“ bereits in den ersten Wochen verloren hatte. Die Solidarität der (westlichen) Welt liegt bei der Ukraine, die diese auf gesellschaftlicher, kultureller und politischer Ebene auch klar zum Ausdruck bringt. Das zeigt sich auch im Bereich der Wirtschaft. Noch nie zuvor gab es derartige Sanktionen gegen Russland. Einzig im militärischen Bereich hat Russland, trotz wesentlicher Rückschläge, die Oberhand, wobei Kampfwille, Kampfwert und Kampfkraft der Ukraine deutlich unterschätzt wurden. Die militärische Operation Russlands wird aus derzeitiger Sicht wohl noch einige Zeit andauern. Prognosen über die Dauer, den Verlauf und den Ausgang des Krieges sind schwierig, da diese von vielen – teils noch unbekannten Parametern – abhängen.
Eine, unter Umständen nachhaltige, Folge des Ukraine-Krieges ist das plötzliche Umdenken in den Staaten Europas in Bezug auf die Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Ein Beispiel dazu ist das von der deutschen Regierung beschlossene Investitionsprogramm in die Streitkräfte mit einem Volumen von 100 Milliarden Euro, nur wenige Tage nach dem Beginn des Krieges.
Oberst dG Mag. Jürgen Wimmer ist Forscher und Leiter des Referat Operation an der Landesverteidigungsakademie