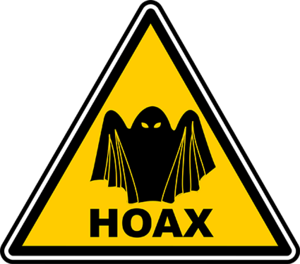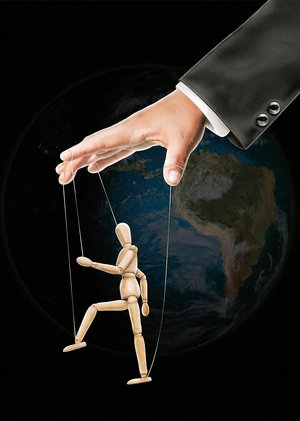Ziel "Panik und Horror"

Europas Demokratien sehen sich zunehmend Manipulationen von außen ausgesetzt. Diese sollen Gesellschaften ängstigen, schwächen und destabilisieren. Fremde Geheimdienste betreiben dazu Kommunikationskampagnen am Rande der Legalität. Beeinflussungen im modernen Informationsraum stoßen auf Widerstand – die EU ergreift Maßnahmen gegen Fake News und Co.
Toxische Kommunikation
Die gegenwärtige sicherheits- und verteidigungspolitische Lage Europas ist von vielschichtigen Phänomenen geprägt, unter anderem hybride Bedrohungen. Darunter versteht man den koordinierten Einsatz offener oder verschleierter, meist legaler Methoden zur gezielten Einflussnahme in Bereichen wie Diplomatie, Militär oder Wirtschaft.Die hybriden Bedrohungen überschreiten grundsätzlich nie die Schwelle zur formellen Kriegsführung. Diese Verschränkung der zivilen und militärischen Bereiche, die zunehmend digital auftritt, ist typisch für moderne Konfliktszenarien.
Diese Form der hybriden Bedrohung benennt der Europäische Auswärtige Dienst mit dem Begriff „Foreign Information Manipulation and Interference“ (FIMI). Auf Deutsch lautet er „Ausländische Informationsmanipulation und Einflussnahme“ und beschreibt Gefahren, die durch staatliche Akteure wie Russland und China, aber auch durch nichtstaatliche Akteure entstehen. Sie möchten das Vertrauen in Demokratien, Institutionen und Regierungen schwächen oder andere Schäden verursachen.
Einerseits umfasst FIMI das Verbreiten falscher Inhalte durch Desinformation und Falschnachrichten sowie irreführender Inhalte durch die Verbreitung von Malinformation. Das sind Informationen, die eigentlich nicht unwahr, aber aus ihrem Kontext gerissen sind. Andererseits können FIMI-Taktiken darüber hinausgehen, beispielsweise bei Cyber-Attacken. Ein grundlegendes Problem für die von Manipulation Betroffenen im Umgang mit FIMI-Kampagnen ist, dass die dabei eingesetzten Methoden weitgehend legal sind und daher in Demokratien nicht einfach verboten werden können.
Informationsumfeld
Das Informationsumfeld setzt sich aus einer infrastrukturellen, einer inhaltlichen und einer kognitiven Dimension zusammen.
Infrastrukturelle Komponente
Sie kann als Träger des Informationsraumes gedacht werden. Darunter fallen die Medien selbst, zum Beispiel Printmedien, Online-Plattformen wie digitale Medien und soziale Netzwerke sowie TV-Sender. Im Zusammenhang mit FIMI ist die Frage der Eigentümerstruktur relevant. Es wird zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren unterschieden. In den europäischen Demokratien sind viele Medienanbieter private Unternehmen, während vor allem in autokratischen Ländern staatliche Medien dominieren. Dies betrifft unter anderem die Frage des verbreiteten Inhaltes, weil staatliche Medien leichter zu kontrollieren sind. Sie verbreiten im Auftrag von Regierungen gezielt Des- oder Falschinformationen. Ein weiterer wichtiger Aspekt befindet sich an der Schnittstelle zur inhaltlichen Komponente. Hier stellt sich die Frage nach der digitalen Souveränität im Hinblick auf die Speicherung und Verarbeitung von Daten und Informationen. Europa verfügt aktuell kaum über bedeutende Cloud-Anbieter oder soziale Medien. Damit besteht eine hohe Abhängigkeit von den USA und von China.
Inhaltliche Komponente
Sie umfasst den gesamten Bereich der Daten, Informationen und des Wissens. Die Relevanz von Information für das Funktionieren und Gelingen einer Gesellschaft kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Mehr als 45 Prozent der Europäer fürchten laut einer Eurobarometer-Umfrage vom März 2024 den Missbrauch ihrer Privatdaten und denken, dass Desinformation einen starken Einfluss auf ihr Leben hat. Wer über die Inhalte bestimmt, die menschliches und institutionelles Handeln sowie maschinelles Verarbeiten beeinflussen, entscheidet darüber mit, wie eine Gesellschaft, ein Staat oder auch das Bundesheer im Inneren verfasst sind und auf welchen Beurteilungsgrundlagen wichtige Entscheidungen fußen.
Kognitive Komponente
Sie betrifft den Menschen selbst, seine Fähigkeit Informationen zu verarbeiten und darauf zu reagieren. Sie fragt danach, wie der menschliche Geist und seine Wahrnehmung, Entscheidungsfindung und sein Urteilsvermögen durch externe und interne Einwirkung beeinflusst werden. Im Zentrum steht also die Frage, was die Grundlage der Entscheidungsfindung einer Person oder einer Gruppe darstellt. In einer demokratischen Gesellschaft ist Vertrauen ein wichtiger Faktor für den inneren Zusammenhalt und das Funktionieren von Institutionen. Sollte dieses durch die gedankliche Überforderung, wie durch Informationsflut, nachhaltig beeinträchtigt werden, kann der gesellschaftliche Zusammenhalt untergraben werden.
FIMI erkennen
Für die Identifikation von FIMI-Operationen haben sich verschiedene flexible Analysemethoden etabliert. Ein gängiges Modell zur Erfassung und Beschreibung von Kampagnen ist das „ABCDE-Modell“.
ABCDE-Modell
- Die Akteurskomponente (A – Actor) des Modells ermöglicht eine Bewertung der an dem Fall beteiligten Akteure.
- Die Verhaltenskomponente (B – Behavior) bewertet, inwieweit Täuschung oder andere unzulässige Kommunikationstechniken Teil des Falles sind und welche Absichten diese verfolgen.
- Die inhaltliche Komponente (C – Content) konzentriert sich auf die Informationen, die verwendet werden, um die Schwere und Problematik des Inhaltes zu bestimmen.
- Die Gradkomponente oder alternativ das „Thermometer“ (D – Degree) gibt Aufschluss über die Verbreitung der betreffenden Inhalte und die Zielgruppen, die sie erreichen.
- Abschließend werden mittels der Wirkungskomponente (E – Effect) Indikatoren für die Auswirkungen analysiert, um zu verstehen, wie groß die Bedrohung ist.
DISARM-Modell
Ein weiteres Untersuchungsmodell ist das „Disinformation Analysis and Risk Management“-Modell (DISARM-Modell), ein Rahmen für die Desinformationsanalyse und das Risikomanagement. Es fokussiert sich vor allem auf Taktiken, Techniken und Verfahren der Manipulation, die in einem FIMI-System angewendet werden.
Folgen
Die Folgen von Beeinflussungsoperationen für Politik und öffentliche Meinung sind schwierig einzuschätzen. Jedoch beschrieb die psychologische Forschung bereits in den 1970er-Jahren den so genannten „Wahrheitseffekt“. Er zeigt, dass jenen Aussagen, die bereits gehört oder gelesen wurden, ein höherer Wahrheitsgehalt zugesprochen wird als solchen, die erstmals wahrgenommen werden. 2012 stellte eine kleine Studie im europäischen „Journal of Psychology“ fest, dass „das Ausgesetztsein gegenüber falschen Nachrichten die wahrgenommene Plausibilität und den Wahrheitsgehalt dieser Nachrichten erhöhte“. Nachrichten verbreiten sich heute meist durch soziale Medien.
Die Reichweite dieser sozialen Netzwerke ist enorm: In Europa verzeichnet YouTube monatlich über 400 Millionen aktive Nutzer, Instagram 270 Millionen, Facebook 260 Millionen und TikTok 150 Millionen. Selbst wenn sich Beeinflussungskampagnen im Internet nur auf einen minimalen Prozentsatz der Nutzer auswirken sollten, wären es letztlich dennoch Millionen manipulierter Menschen.
Wie damit umgehen?
Die Frage nach dem Umgang mit derartigen FIMI-Kampagnen wirft sowohl auf der gesellschaftlichen als auch auf der individuellen Ebene Herausforderungen auf. Die Schwierigkeiten sind institutioneller und psychologischer Natur. Die Attribuierung, also die zweifelsfreie Rückverfolgung und Zuweisung der Aktivitäten zu den verantwortlichen Akteuren, ist anspruchsvoll. Zudem unterscheiden sich Desinformationen, wie irreführende oder falsche Inhalte politischer Natur, von anderen Arten von Inhalten, die demokratische Regierungen bereits regulieren. Beispielsweise haben die meisten Demokratien Anstiftungen zur Gewalt, terroristische Inhalte, Betrug, irreführende Werbung, Verleumdung, Verletzungen von Urheberrecht und Bildrechten zur illegalen Verletzung der Rechte des Einzelnen erklärt.
Zugleich ist die Regulierung von Inhalten, die zwar legal, aber schädlich sind, grundsätzlich heikel, weil unter anderem Freiheitsrechte, wie das Recht auf freie Meinungsäußerung, gewahrt werden müssen. Dazu ist die Bestimmung des Wahrheitsgehaltes von Informationen, gerade bei polarisierenden gesellschaftlichen oder politischen Themen, oft komplex. Darüber hinaus übersteigt die globale Reichweite sozialer Netzwerke nationale und sogar supranationale Rechtsordnungen.
Projekt Kylo
Anhand des realen Beispieles „Projekt Kylo“ können die verschiedenen Dimensionen des Informationsumfeldes dargestellt werden. Erst deren ineinandergreifendes Harmonieren ermöglicht eine erfolgreiche FIMI-Kampagne. Das deutsche Magazin „Der Spiegel“ und das Investigativportal „The Insider“ berichteten im Sommer 2024 über eine Informationsoperation des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR (Sluschba wneschnei raswedki) mit dem Codenamen „Projekt Kylo“. Dieses Projekt ist eine exemplarische Fallstudie, die Ziele, Methoden, Konsequenzen und Herausforderungen einer modernen FIMI-Kampagne illustriert.
„Panik und Horror“
Die Informationen über die Operation entstammen Geheimdienstunterlagen, die kremlkritische russische Hacktivisten – sie verwenden Computer und Rechnernetze als Protestmittel – durch eine Cyber-Attacke erlangt und den Redaktionen zugespielt haben. Diese Korrespondenz und Dokumente zeigen, wie ein umfassendes Strategiepapier für den Informationskrieg mit dem Westen entstand.
Mikhail Kolesov, ein 45-jähriger Agent des Auslandsgeheimdienstes, gilt als der Architekt des Projektes. Er definiert das Kampagnenziel so: Es gehe darum, in Europa Angst zu erzeugen. Das müsse das neue Leitmotiv der Bemühungen sein. Es gelte, Ängste vor einer unsicheren Zukunft zu wecken und das Unterbewusstsein des Zielpublikums mit „kognitiven Attacken“, „Panik und Horror“ zu überwältigen. Russland solle sich darauf konzentrieren, Angst und Unsicherheit auszulösen, um die Unterstützung für die Ukraine zu schwächen und westliche Gesellschaften zu spalten.
Kampagnen müssten auf jene „70 bis 80 Prozent normaler Menschen“ abzielen, die vor allem über die „psycho-emotionale Ebene“ erreichbar und manipulierbar seien. Diese „kognitive“ Strategie, so Kolesov, müsse an Gefühle appellieren, allen voran an die stärkste Emotion: Angst.
Inszenieren und manipulieren
Kolesovs Vorschlag, den er in einem Dokument mit dem Titel „Propaganda“ skizziert, sieht einen systematischen und offensiven Ansatz zur Informationskriegsführung vor. Die Strategie umfasst zahlreiche Taktiken, darunter das Inszenieren von Protesten in europäischen Städten. Anschließend werden Videoaufnahmen im Internet verbreitet, „Nachrichten“-Websites erstellt und Plattformen wie „YouTube“ genutzt, um manipulative Inhalte zu streuen – anstelle russischer Medien wie „Sputnik“ oder „Russia Today“.
Den Unterlagen zufolge startete diese Manipulationsstrategie im Jahr 2022, kurz nach dem Überfall auf die Ukraine, weil Russland mit der öffentlichen europäischen Wahrnehmung des Ukraine-Krieges unzufrieden war.
Fake News und gesteuerte Demos
Es scheint, dass einige Taktiken, die in den durchgesickerten Dokumenten beschrieben wurden, in Europa bereits umgesetzt werden. Deutsche Behörden haben über zwei Dutzend augenscheinlich vertrauenswürdige Nachrichten-Websites identifiziert, die die ukrainische Flüchtlingsthematik instrumentalisieren und in fließendem Deutsch Überschriften wie „Wie Ukrainer Deutschland des wirtschaftlichen Wohlstandes berauben“ veröffentlichen.
Damit verbunden sind Hunderttausende Konten auf sozialen Netzwerken, die plakative Sprüche wie „Deutschland versinkt in Obdachlosigkeit“ oder „Selbst Brot wird zum Luxusgut“ posten und zu den besagten Nachrichten-Websites zurücklinken.
Darüber hinaus ereigneten sich 2023 in europäischen Städten wie Paris, Brüssel, Den Haag oder Madrid Proteste gegen westliche Waffenlieferungen an die Ukraine, in denen teils dieselben Männer demonstrierten. Recherchen eines europäischen Medienkonsortiums, an dem die Zeitung „Le Monde“ und die „Süddeutsche Zeitung“ beteiligt waren, deuteten später darauf hin, dass diese Männer vom russischen Geheimdienst angeheuert worden waren.
Hindernisse
Mehrere psychologische Mechanismen erschweren die Bewältigung von digitalen Beeinflussungsoperationen. Die menschliche Informationsverarbeitung ist allgemein verschiedenen kognitiven Verzerrungen unterworfen, z. B. dem „Confirmation Bias“. Dieser besagt, dass Menschen dazu tendieren, Informationen so auszusuchen und zu interpretieren, dass diese eigene Ansichten bestätigen. Wenn man diese Neigung nun in den Kontext von sozialen Medien setzt, ergibt sich folgendes Bild: Nur eine kleine Anzahl von sozialen Netzwerken dominiert die digitale Welt. Diese wurden so programmiert, dass Nutzer sie möglichst häufig und lange nutzen sollen, um den Umsatz der Plattformbetreiber zu steigern.
Diese Ausrichtung steuern Black-Box-Algorithmen. Sie zählen zu den wichtigsten Kuratoren, die den Medienkonsum von Nutzern bestimmen. Darunter versteht man KI-Modelle, bei denen nicht immer erklärbar ist, warum ein Modell eine bestimmte Entscheidung erzeugt hat und welche Kombination an Eingabefaktoren dazu geführt hat. Untersuchungen haben gezeigt, dass diese Algorithmen Nutzer oft zu extremen Inhalten steuern, insbesondere auf den zwei größten Plattformen, Facebook und YouTube. In Filterblasen zeigen Algorithmen Nutzern verstärkt Inhalte an, die mit deren Interessen und Weltsicht übereinstimmen. Dadurch werden Überzeugungen gefestigt. Es ergibt sich also für den Umgang mit FIMI-Kampagnen eine vertrackte Gemengelage.
Gegenmaßnahmen
Ein solides und umfassendes Lagebild über FIMI-Aktivitäten ist die Voraussetzung für effektive Gegenmaßnahmen. Diese sind in sämtlichen politischen und gesellschaftlichen Bereichen erforderlich, um das notwendige Maß an Widerstandsfähigkeit gegenüber unerwünschten Beeinflussungen und Manipulationen auszubilden.
Grundlagenpaket
Da die Bedrohung häufig einen transnationalen Charakter aufweist, ist die EU in Europa ein zentraler Akteur beim Bekämpfen von FIMI-Aktivitäten. Sie verfügt mittlerweile über ein umfangreiches strategisches Rahmenwerk, das 2018 mit dem „Aktionsplan gegen Desinformation“ startete. Dieser beinhaltet unter anderem einen freiwilligen Verhaltenskodex für Online-Plattformen sowie den Ausbau der Fähigkeiten zur Identifikation von Desinformationen.
Zahlreiche maßgebliche Dokumente folgten, wie 2020 der „Aktionsplan für Demokratie“ zur Stärkung der Medienfreiheit und des Kampfes gegen Desinformation, 2022 der „Strategische Kompass“ zur Stärkung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU bis 2030 und 2024 schließlich der „Digital Services Act“ mit Verhaltenspflichten für Anbieter von Vermittlungsdiensten wie Online-Plattformen. Das „Medienfreiheitsgesetz“ von 2024 ist ein weiterer wichtiger Teil in diesem Grundlagenpaket. Durch diesen Schutz der redaktionellen Unabhängigkeit, aber auch durch die Transparenz bei Eigentumsverhältnissen von Medien, sollen Pluralismus und Unabhängigkeit in der EU sichergestellt werden.
Maßnahmen
Die Kernkomponente im Kampf gegen FIMI-Aktivitäten ist die „FIMI-Toolbox“, die Ende 2023 vorgestellt wurde. Sie konzentriert sich auf vier übergreifende Handlungsfelder:
- Lagebewusstsein;
- Resilienz;
- Regulierung;
- außenpolitisches Handeln der EU.
Jeder Bereich umfasst verschiedene Arten von Instrumenten, die das Potenzial haben, die Auswirkungen von FIMI zu verhindern oder zu verringern, Akteure von manipulativen Aktivitäten abzuhalten und auf diese zu reagieren. Die EU-Mitgliedstaaten, gleichgesinnte internationale Partner sowie Organisationen der Zivilgesellschaft und die Privatwirtschaft tragen zur Stärkung dieses Instrumentariums bei.
Datenbank gegen Desinformation
„EUvsDisinfo“, ein Projekt des Europäischen Auswärtigen Dienstes zur Sensibilisierung für russlandfreundliche Informationsmanipulation und Desinformation, erreichte im Jahr 2023 über seine Social-Media-Kanäle über 20 Millionen Menschen. Die Plattform unterhält mit über 18 000 Fällen die weltgrößte öffentlich zugängliche Datenbank von russlandfreundlichen Desinformationsfällen.
Projekt EDMO
Eine wichtige Rolle beim Erkennen und Bekämpfen von Desinformation hat die Zivilgesellschaft. Die EU unterstützt zahlreiche Organisationen und Kampagnen zur Stärkung der Medienkompetenz, insbesondere zur unabhängigen Analyse und Bekämpfung von Desinformation, etwa durch das Europäische Fakten-Checker-Netzwerk oder das Projekt EDMO (European Digital Media Observatory – Europäische Beobachtungsstelle für digitale Medien).
Kerngruppe Desinformation
In Österreich nimmt die gesamtstaatliche „Kerngruppe Desinformation“ Herausforderungen an, die durch ausländische Informationsmanipulation und Einflussnahme entstehen. Sie ist Teil der gesamtstaatlichen „Arbeitsgruppe Hybride Bedrohungen“, an der das BMLV beteiligt ist. Die Arbeitsgruppe fokussiert sich auf eine bessere interministerielle Koordinierung sowie auf das Stärken der Resilienz.
Fazit
FIMI-Kampagnen sind eine substanzielle Bedrohung und Herausforderung für demokratische Prinzipien und Werte sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Möglichkeiten für eine wirkungsvolle Beeinflussung in Europa sind eng mit der Frage der digitalen Souveränität verbunden, also der Fähigkeit Europas, eigenständig in der digitalen Sphäre zu handeln. Die Erscheinungsformen von Desinformation sind vielfältig. Sie reichen von manipulierten Inhalten auf einer Website über KI-generierte Fälschungen wie „Deepfakes“ auf Online-Plattformen bis zur Verbreitung einseitiger Narrative über herkömmliche Medien.
Das Erkennen von FIMI-Kampagnen und der Kampf dagegen erfordern eine gesamtheitliche Betrachtung sowie eine sektoren- und staatenübergreifende Kooperation. Die Stärkung der institutionellen und gesellschaftlichen Widerstandsfähigkeit ist ein wesentlicher Faktor für die erfolgreiche Abwehr solcher Beeinflussungs- und Manipulationsversuche.
Oberst dhmfD Mag.(FH) Daniel Hikes-Wurm, MA, MAS; Generaldirektion für Verteidigungspolitik
Milena Sagawa-Krasny, BSc; Generaldirektion für Verteidigungspolitik

Dieser Artikel erschien im TRUPPENDIENST 1/2025 (402).